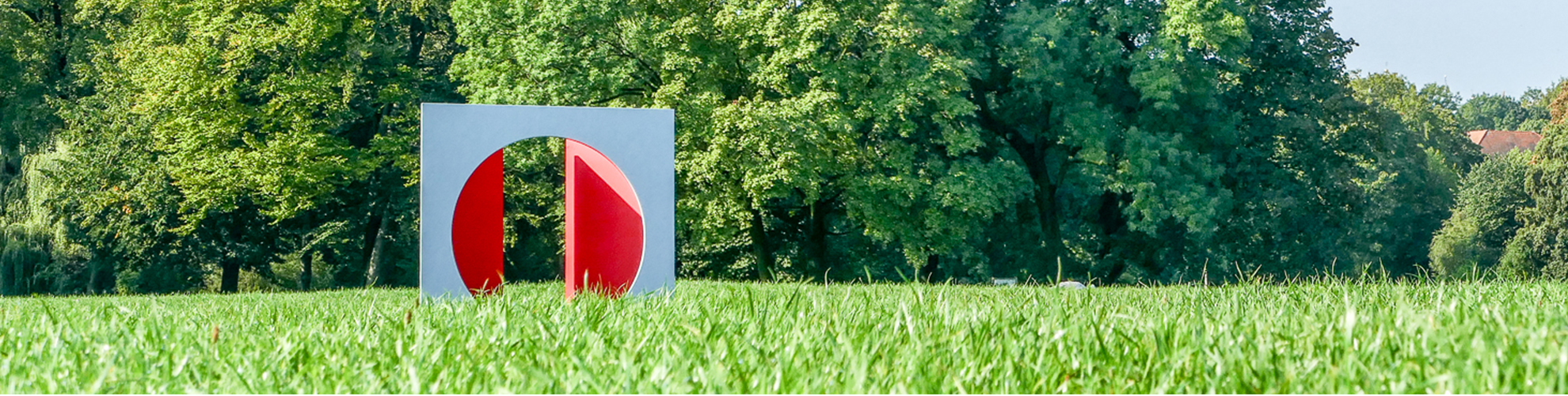

Der Ausgrenzung psychisch erkrankter Menschen entgegenwirken
Ein Portrait der Bayerischen Gesellschaft für psychische Gesundheit e. V.
Im Gespräch mit Margit Klemer, geschäftsführender Vorstand
Wie würden Sie jemandem, die oder der noch nie von der Bayerischen gehört hat, Ihren Verein und die Arbeit, die er leistet, beschreiben?
Wir unterstützen, beraten und begleiten seit mehr als 45 Jahren psychisch erkrankte Menschenin allen Lebenslagen – vor, während und nach einer stationär-psychiatrischen Behandlung in der Klinik. Wir sind auch für deren Angehörige und ihnen nahestehende Menschen da. Am wichtigsten ist uns, Ausgrenzung entgegenzuwirken, nur, weil jemand anders oder „besonders“ ist. Zusammen mit psychisch erkrankten und behinderten Menschen setzen wir uns ein gegen Diskriminierung und Ausgrenzung, für Akzeptanz und Integration.
Was versteht man unter „psychisch krank“?
Eine psychische oder seelische Erkrankung ist eine dauerhafte oder wiederkehrende Beeinträchtigung der Wahrnehmung, des Denkens, Fühlens oder Verhaltens. Das Selbstbildkann verändert sein, auch die Möglichkeit der Selbstregulation ist oft vermindert. Psychische Störungen treten in vielfältigen Erscheinungsformen auf und können großes persönliches Leiden verursachen.
Psychisch zu erkranken, kann jeden Menschen treffen.
Was sind Ihrer Erfahrung nach die häufigsten Ursachen für psychische Erkrankungen?
Psychisch zu erkranken, kann jeden Menschen treffen. Entscheidend für die psychische Gesundheit ist, eine Balance zwischen den Anforderungen und Belastungen einerseits und den Ressourcen und möglichen Verhaltensalternativen andererseits hinzubekommen. Diese Balance kann sich mit jeder Lebensphase wie auch nach einschneidenden Ereignissen verlagern.
Wir verstehen psychische Erkrankung als ein Zusammenspiel biologischer, psychologischer und sozialer Faktoren. Nach dem Vulnerabilitätsmodell ist bei einigen Menschen die persönliche Verletzlichkeit besonders groß. Das kann das Risiko erhöhen, bei akuten Belastungen, Stressauslösern und schwierigen Lebensereignissen psychisch zu erkranken.
Früher hat man Menschen mit psychischen Erkrankungen weggesperrt, versteckt, unter den Nationalsozialisten sogar umgebracht. Wie werden psychisch erkrankte Menschen in unserer Gesellschaft heute gesehen?
Guckt man sich an, wie psychische Erkrankungen in der Gesellschaft wahrgenommen werden, wird deutlich, dass wir noch viel Aufklärungsarbeit leisten müssen. Auch wenn die Offenheit gegenüber diesen Themen steigt, verschwinden bestehende Vorurteile nur langsam. Psychisch erkrankte Menschen stellen in unserer Gesellschaft immer noch eine Randgruppe dar. Oft werden sie stigmatisiert und diskriminiert, ohne dass die Bevölkerung etwas über die Erkrankung und ihren Verlauf weiß. Das reicht von sozialer Distanz bis zur offenen Ablehnung.
Eines muss man aber auch festhalten: Die Gesellschaft unternimmt alle erdenklichen Anstrengungen, um psychisch erkrankten Menschen immer bessere Behandlungsangebote zur Verfügung zu stellen. In den letzten Jahrzehnten ist die Versorgung in den psychiatrischen Kliniken und auch außerhalb enorm ausgebaut worden – verbunden mit dem ehrlichen Interesse, die Lebenssituation betroffener Menschen zu verbessern.
Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass weltweit
etwa 300 Millionen Menschen von Depressionen,
47,5 Millionen von Demenz und 21 Millionen
von Schizophrenie betroffen sind.
Haben psychische Erkrankungen zugenommen? Die Zahlen der Krankenkassen scheinen das zum Beispiel bei Depressionen nahezulegen.
Depressionen gehören zu den am weitesten verbreiten Erkrankungen. Man muss aber unterscheiden: Es gibt nicht „die“ psychischen Erkrankungen, sondern leichtere und schwerere Erkrankungsformen. Zu den schwereren psychiatrischen Krankheitsbildern gehören zum Beispiel Schizophrenie, bipolare Störungen oder die schwere, das heißt die klinische Depression.
Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass weltweit etwa 300 Millionen Menschen von Depressionen, 47,5 Millionen von Demenz und 21 Millionen von Schizophrenie betroffen sind. Depression wird weltweit neben posttraumatischen Belastungsstörungen am häufigsten festgestellt.
Die Diagnosen haben zugenommen. Das bedeutet jedoch keineswegs, dass psychische Störungen heute häufiger vorkommen als früher. Man könnte es auch so deuten, dass nicht die Zahl der Kranken, sondern die der Diagnosen gestiegen ist. Unabhängig davon wissen wir mittlerweile sehr viel mehr über mögliche Risikofaktoren und spezifische Behandlungsmöglichkeiten.
Gibt es bestimmte Bevölkerungs- oder Altersgruppen, die von psychischen Erkrankungen besonders betroffen sind, zum Beispiel ältere Menschen?
Risikofaktoren für die psychische Gesundheit sind tatsächlich in der Arbeitswelt, im Übergang zum Erwachsenwerden, beim Älter-Werden und nach extrem belastenden Ereignissen oder einschneidenden Veränderungen im Leben eines Menschen zu finden.
Wir sind ein starker Partner bei
den nicht-klinischen psychiatrischen Hilfsangeboten.
Welchen Platz nimmt die Bayerische im gesamten Angebot zur Versorgung psychisch erkrankter Menschen in Bayern ein?
Wir sind offen für alle psychisch erkrankten Menschen. Unser Schwerpunkt liegt derzeit in den Bereichen „Hilfen zum Wohnen“, „offene Beratungsarbeit“ und bei der „Führung von gesetzlichen Betreuungen“. Uns liegt sehr daran, für psychisch erkrankte Menschen immer auch weitere innovative Angebote und Leistungen bereitzuhalten.
Wir sind ein starker Partner bei den nicht-klinischen psychiatrischen Hilfsangeboten. Neben allgemeinen Hilfen für psychisch erkrankte Menschen leisten wir auch forensische Nachsorge, begleiten psychisch erkrankte Jugendliche und junge Heranwachsende und unterstützen psychisch erkrankte Eltern.
Wie sind psychisch erkrankte Menschen generell in Bayern versorgt? Reichen die verschiedenen Angebote? Wenn nein, wo und was muss sich ändern?
Seit 1973, als der Bericht über die Lage der Psychiatrie in der Bundesrepublik Deutschland – die sogenannte Psychiatrie-Enquete – vorgestellt wurde, hat sich unendlich viel getan. Damals hatte eine Sachverständigenkommission im Auftrag des Bundestages rund 200 Mitarbeiter*innen aus allen Bereichen der Psychiatrie befragt. Diese berichteten über schwerwiegende Mängel bei der Versorgung psychisch Kranker. In der Enquete wurde festgestellt, „daß eine sehr große Anzahl psychisch Kranker und Behinderter in den stationären Einrichtungen unter elenden, zum Teil als menschenunwürdig zu bezeichnenden Umständen leben müssen“. Die wichtigste Forderung der Sachverständigenkommission war die nach „Sofortmaßnahmen zur Befriedigung humaner Grundbedürfnisse“.
Die Bayerische Gesellschaft wurde 1970 gegründet. Sie ist mit all ihren Angeboten ein Kind der sich anschließenden Psychiatrie-Reformbewegung.
Und doch bleibt noch viel zu tun…
Ja, die Reform ist noch nicht zu Ende. Es fehlen bezahlbarer Wohnraum für psychisch kranke Menschen, Arbeitsplätze oder entlohnte „sinngebende“ Betätigungsmöglichkeiten außerhalb der psychiatrischen Versorgungslandschaft und der Klinik, die dem schwankenden Leistungsvermögen dieser Menschen Rechnung tragen.
Es fehlt noch immer nachts und an Wochenenden oder Feiertagen eine flächendeckende, ambulant aufsuchende Krisenunterstützung. Es fehlen qualifizierte Psychotherapeut*innen, die auch Menschen mit Psychose-Erfahrung in ihrer Psychotherapie begleiten können, wenn sie dies wünschen.
Was beschäftigt die Bayerische darüber hinaus am meisten?
Die mangelnde finanzielle Unterstützung, um auch präventiv arbeiten zu können.
Das geplante Bayerische Psychisch-Kranken-Hilfegesetz, in dem mehr Sanktionen und Sicherungsaspekte als Hilfen beschrieben sind, macht uns Kopfzerbrechen. Oder auch die Änderungen durch das neue Bundesteilhabegesetz und die Frage, wie wir als Träger damit zurechtkommen.
Die Versorgung geflüchteter Menschen, die traumatisiert sind,
sieht schlecht aus.
Nehmen Sie sich auch geflüchteter Menschen an, die traumatisiert sind? Wie sieht da die Versorgung aus?
Schlecht!! Diese Menschen sind bisher kaum bei uns, nur in Einzelfällen. Leider, denn wir dürfen nicht. Der Zugang von Menschen mit Migrationshintergrund zu sozialrechtlichen Leistungen hängt von ihrem aufenthaltsrechtlichen Status ab, nicht aber von der Staatsbürgerschaft. Nur für Eingewanderte mit deutscher Staatsangehörigkeit oder einem aufenthaltsrechtlich gesicherten Status als Migrant*in oder Flüchtling gelten die gleichen sozialrechtlichen Regelungen wie für Deutsche ohne Zuwanderungsgeschichte.
Problematisch ist die sozialrechtliche Situation nicht anerkannter Flüchtlinge, Asylsuchender und Geduldeter. Diese Gruppen erhalten Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Das bedeutet, dass ihnenin den ersten fünfzehn Monaten lediglich eine medizinische Grund- beziehungsweise Minimalversorgung zusteht.
Für besonders Schutzbedürftige, also auch für Menschen mit Behinderung, können sonstige Leistungen erbracht werden, „wenn sie im Einzelfall zur Sicherung der Gesundheit unerlässlich“ sind. Vielfach unterbleiben aber dadurch dringend erforderliche therapeutische Maßnahmen; diese sowie die Versorgung mit adäquaten Hilfsmitteln müssen eingeklagt werden.
Asylbewerber und Geduldete haben in der Regel keinen Anspruch auf Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung; nur in Härtefällen gibt es Ausnahmen.
Wie schaffen es Ihre Mitarbeiter*innen, dieser oft nicht leichten Aufgabe gewachsen zu sein?
Durch Empathie, aber auch durch die Fähigkeit sich abzugrenzen. Durch die Lust, Beziehung aufzunehmen, durch die Lust auf Neues und auch auf das „Ver-Rückte“ oder Menschen immer wieder neu zu begegnen. Hilfreich ist auch ein glückliches Privatleben.
Wir achten auf eine gute, tragfähige Teamzusammenstellung, auf kollegiale Beratung, Supervision und gezielte Fortbildung. Wer bei uns arbeitet, sollte gerne bei einem mittelständischen, freien Träger selbstständig mitgestalten und zupacken.
Welche Ziele hat sich die Bayerische für die nächsten fünf bis zehn Jahre gesetzt?
Immer flexibel bleiben, neue Projekte anschieben oder Konzepte so überarbeiten, dass sie die den psychisch erkrankten Menschen nutzen und dienlich sind.
Was lieben Sie an Ihrer Arbeit?
Sie ist abwechslungsreich, spannend und unvorhersehbar. Ich freue mich, wenn es gut läuft und unsere Arbeit hilfreich ist. Ich liebe die Arbeit mit Menschen, die einen auch selber bereichert, und wenn man etwas bewegen kann.
Unsere Arbeit sollte der Gesellschaft und der Wirtschaft
mehr wert sein!
Noch etwas, das Ihnen wichtig ist, Ihnen am Herzen liegt?
Frauen sind im sozialen Bereich überproportional vertreten, bereits aber ab der mittleren Führungsebene sind sie auch bei uns kaum mehr wiederzufinden.
Der Fachkräftemangel beschäftigt auch uns. Er ist nur durch bessere, adäquate Bezahlung für Menschen in sozialen, pflegerischen und Gesundheitsberufen zu beseitigen.
Soziale Träger brauchen mehr Selbstbewusstsein. Wir alle helfen doch der Gemeinschaft, der Gesellschaft und tragen dazu bei, dass der Standort Deutschland sicher und attraktiv ist. Das sollte der Gesellschaft und der Wirtschaft mehr wert sein!
Geschäftsstelle Verein
Leitung: Margit Klemer
Preysingstraße 30
81667 München
Telefon: 0 89 45 86 78 9-0
Telefax: 0 89 45 86 78 9-22
E-Mail: info@bgfpg.de
Region Oberbayern
Leitung: Beate Dirkmann
Arnulfstraße 22
80335 München
Telefon: 0 89 55 99 97 8-40
Telefax: 0 89 55 99 97 8-10
E-Mail: oberbayern@bgfpg.de
Region Regensburg
Leitung: Andreas Kinadeter
Rote-Hahnen-Gasse 6
93047 Regensburg
Telefon: 09 41 59 93 59-10
Telefax: 09 41 59 93 59-70
E-Mail: regensburg@bgfpg.de
Region Allgäu
Leitung: Ingrid Böhm
Bad Wörishofer Str. 4
87719 Mindelheim
Telefon: 0 82 61 7 63 70-10
Telefax: 0 82 61 7 63 70-11
E-Mail: ingrid.boehm@bgfpg.de
Region Passau
Leitung: Robert Hanke
Grabengasse 9
94032 Passau
Telefon: 08 51 93 40 83
Telefax: 08 51 93 47 47-7
E-Mail: passau@bgfpg.de
